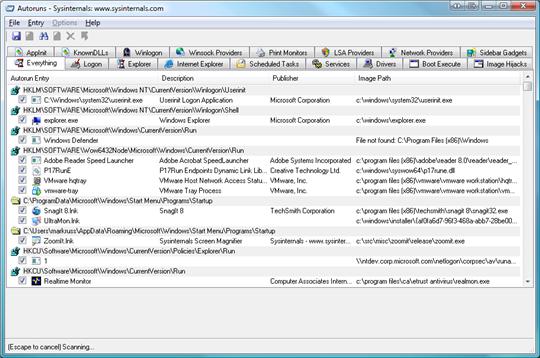Der Scheidenkrebs - Ursache und Therapie (Gesundheit)
Scheidenkrebs (Vaginalkarzinom)
Scheidenkrebs kommt sehr selten vor und betrifft in erster Linie ältere Frauen. Der Tumor wächst oft lange Zeit, ohne dass Symptome auftreten. Blutungen aus der Scheide, die zum Beispiel nach Sexualkontakt auftreten, können jedoch ein Hinweis sein.
Was ist Scheidenkrebs (Vaginalkarzinom)? Warum Scheidenkrebs entsteht, ist nicht genau bekannt. Als Risikofaktor gilt aber eine Infektion mit humanen Papillomviren (HPV-Infektion). Ursachen und Risikofaktoren Die genauen Ursachen von Scheidenkrebs sind bislang unklar. Eine Infektion mit humanen Papillomviren (HPV, insbesondere HPV 16 und HPV 18) erhöht jedoch das Risiko, daran zu erkranken. Was genau Scheidenkrebs verursacht, wissen Forscher bis heute nicht. Als wichtigster Risikofaktor gilt allerdings eine Infektion mit humanen Papillomviren (HPV, vor allem HPV 16 und HPV 18). Beim Gebärmutterhalskrebs gilt eine lang anhaltende Infektion mit humanen Papillomviren aus der Hochrisiko-Gruppe inzwischen als notwendige Voraussetzung für die Entstehung eines Karzinoms. Therapie Die Therapie hängt vom Stadium der Tumorerkrankung ab. Bei Scheidenkarzinomen steht als erste Behandlung vor allem die Strahlentherapie im Vordergrund. Besonders im Stadium I kommt auch primär eine Operation in Betracht. Wie Scheidenkrebs im Einzelfall behandelt wird, hängt von der Lage, der Größe und der Ausbreitung des Tumors ab. Auch der Allgemeinzustand der Patientin sowie der zu erwartende Erfolg des Eingriffs spielen bei der Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Therapie eine Rolle. Zudem muss der Chirurg in diesem Stadium die Scheide oft nicht vollständig entfernen. Ist der Scheidenkrebs jedoch weiter fortgeschritten, muss gegebenenfalls die gesamte Vagina entfernt werden. In diesem Fall ist je nach persönlicher Situation und Wünschen der betroffenen Patientin die Bildung einer künstlichen Scheide (zum Beispiel aus Dickdarmgewebe) möglich. Die regelmäßige Krebsvorsorge beim Frauenarzt stellt die wichtigste Früherkennungsmaßnahme dar. Gehen Sie regelmäßig zur Vorsorge-Untersuchung beim Frauenarzt. Scheidenkrebs wird meist zufällig im Rahmen der Krebsfrüherkennung entdeckt. Vor allem ältere, sexuell nicht mehr aktive Frauen vernachlässigen oft die Früherkennungsuntersuchung, was eine zu späte Diagnose des Vaginalkarzinoms zur Folge haben kann.
Scheidenkrebs ist eine sehr seltene Tumorerkrankung. Am häufigsten erkranken Frauen im Alter zwischen 60 und 70 Jahren daran. In etwa 90 Prozent der Fälle entwickelt sich ein primäres Vaginalkarzinom aus der obersten Zellschicht der Scheidenschleimhaut. Es handelt sich dabei um sogenannte Plattenepithelkarzinome.
Die meisten Tumoren, die in der Scheide vorkommen, entstehen jedoch nicht primär in der Schleimhaut der Vagina, sondern durch bösartige Tumoren in Nachbarorganen. So kann zum Beispiel ein bösartiger Tumor im Gebärmutterhals (Zervixkarzinom) oder im Bereich der Schamlippen (Vulvakarzinom) in das Scheidengewebe einwachsen. Mediziner sprechen dann von sekundären Malignomen.
![]()
Anfangs verursacht Scheidenkrebs kaum Beschwerden, weswegen er oft erst spät entdeckt wird. Blutungen aus der Scheide, vor allem nach dem Geschlechtsverkehr, werden am häufigsten beobachtet. Die Diagnose stellt meist der Frauenarzt (Gynäkologe), nachdem er bei der Krebsvorsorge Auffälligkeiten entdeckt hat. Die Therapie hängt davon ab, wie weit der Krebs fortgeschritten ist und welcher Bereich der Scheide befallen ist.
Einen weiteren Risikofaktor stellte die Behandlung mit dem Medikament Diethylstilbestrol (ein künstliches Östrogen, mit dem früher Schwangere zur Verhinderung einer Fehlgeburt behandelt wurden) dar. Bei Mädchen, deren Mütter Diethylstilbestrol in der Schwangerschaft eingenommen hatten, wurde häufiger Scheidenkrebs beobachtet; das Medikament wurde jedoch bereits 1971 vom Markt genommen.
In den Anfangsstadien der Erkrankung sind die Behandlungserfolge durch Operation und Strahlentherapie vergleichbar gut.
Nach einer Operation kann eine anschließende Strahlentherapie sinnvoll sein. Dadurch können noch im Körper verbliebene Krebszellen zerstört werden. Eine Strahlentherapie kann dem chirurgischen Eingriff auch vorausgehen, um beispielsweise die Größe des zu operierenden Tumors zu verkleinern.
In fortgeschrittenen Tumorstadien, oder wenn eine Operation nicht möglich ist, stellt die Strahlentherapie die Therapie der Wahl dar. Insgesamt kommt sie bei etwa 80 Prozent aller Patientinnen mit Scheidenkarzinom zum Einsatz.
Im Gegensatz zu anderen Krebsarten spielt die Chemotherapie bei Scheidenkrebs eine untergeordnete Rolle. Wenn, dann wird sie meist in Kombination mit einer Bestrahlung eingesetzt.
Vorbeugen
Eine Infektion mit humanen Papillomviren (HPV) gilt als wichtigster Risikofaktor für Scheidenkrebs. Oft stecken sich junge Frauen bereits beim ersten Geschlechtsverkehr mit den Viren an. In den meisten Fällen bereiten die Viren keine Probleme und werden vom Körper rasch wieder eliminiert. Nur sehr selten können sich in Folge einer anhaltenden Infektion Krebsvorstufen entwickeln – meist Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs. Eine HPV-Impfung schützt vor der Infektion mit den zwei wichtigsten krebserregenden HP-Viren. Der HPV-Impfstoff ist auch zur Vorbeugung von Krebsvorstufen der Scheide zugelassen. Ob sich eine HPV-Impfung für ein Mädchen empfiehlt, sollte mit dem Gynäkologen besprochen werden. Kondome schützen vor Geschlechtskrankheiten und Infektionen der Scheide, können aber eine Infektion mit humanen Papillomviren nicht sicher verhindern.