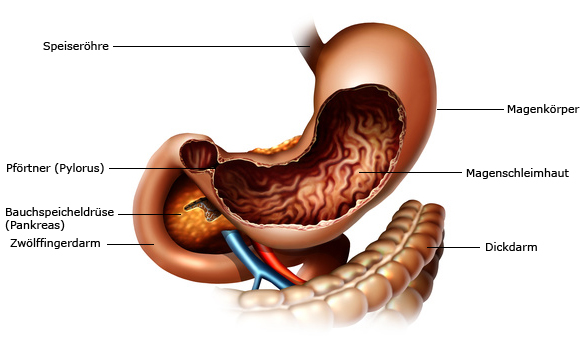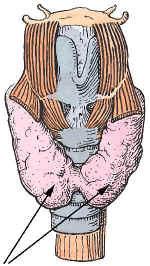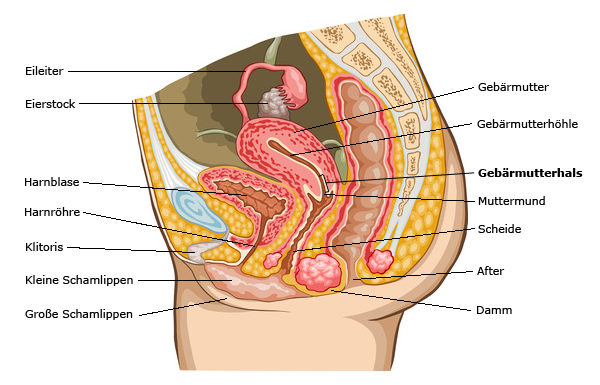Chronische Leukämie (Gesundheit)
Leukämien werden umgangssprachlich oft als "Blutkrebs" bezeichnet. Medizinisch betrachtet ist das allerdings nicht ganz korrekt: Der Begriff steht vielmehr für eine Gruppe von bösartigen Erkrankungen, die das blutbildende System betreffen. Dieses besteht aus dem Knochenmark und dem lymphatischen System.
Was versteht man unter Blutbildung?
Im Blut lassen sich drei Zelltypen unterscheiden:
die für den Sauerstofftransport verantwortlichen roten Blutkörperchen (Erythrozyten)
die an der Blutgerinnung beteiligten Blutplättchen (Thrombozyten) und
die weissen Blutkörperchen (Leukozyten), die eine zentrale Rolle im menschlichen Immunsystem besitzen.
Die verschiedenen Blutzelltypen entwickeln sich im Knochenmark aus gemeinsamen Vorläuferzellen, den Stammzellen der Blutbildung. Unter dem Einfluss von diversen Wachstumsfaktoren reifen die Blutstammzellen zu voll funktionsfähigen Leukozyten, Erythrozyten und Thrombozyten heran, die in weiterer Folge in die Blutbahn übertreten.
Bei einer Leukämie ist der normale Reifungsprozess der weissen Blutkörperchen gestört bzw. unterbrochen. Anstelle von vollständig ausdifferenzierten Leukozyten werden mehr oder weniger unausgereifte weisse Blutkörperchen gebildet. Diese entarteten Zellen nennt man Leukämiezellen.
Leukämiezellen sind nicht in der Lage, die Funktion von gesunden Leukozyten zu übernehmen. Darüber hinaus haben sie die Eigenschaft, sich unkontrolliert zu vermehren und auszubreiten. Dies hat letztlich Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Deshalb werden Leukämien auch als bösartige Systemerkrankungen bezeichnet.
Nach dem Verlauf unterscheidet man akute Leukämien und chronische Leukämien:
Akute Leukämien entwickeln sich rasch und gehen mit schweren Krankheitszeichen einher. Bleibt eine Behandlung aus, verlaufen sie innerhalb weniger Wochen und Monate lebensbedrohlich.
Chronische Leukämien sind schleichende Erkrankungen, die langsam fortschreiten und oft über einen längeren Zeitraum unbemerkt bleiben. Die Leukämiezellen sind bei den chronischen Formen ausgereifter als bei den akuten. Das bedeutet, die Entartung findet auf einer späteren Stufe des Entwicklungsprozesses statt.
Welche Formen der chronischen Leukämie gibt es?
Die Gruppe der weissen Blutkörperchen wird in mehrere "Arten" (Subtypen) unterteilt, die unterschiedlich aussehen und unterschiedliche Funktionen besitzen. Je nachdem, aus welchem Leukozyten-Subtyp die Leukämiezellen hervorgehen, werden die chronischen Leukämien in zwei Gruppen eingeteilt:
Während bei der chronischen lymphatischen Leukämie (CLL) die Lymphozyten und ihre Vorläuferzellen entarten, nimmt die chronische myeloische Leukämie (CML) ihren Ursprung bei Zellen der sogenannten myeloischen Reihe, aus der etwa die Granulozyten und Monozyten hervorgehen. Mit speziellen Laboruntersuchungen können sowohl die CML als auch die CLL noch weiter unterteilt werden. Die chronische lymphatische Leukämie wird zwar immer noch zu den Leukämien gezählt, im Grunde handelt es sich aber eher um eine Sonderform der malignen Lymphome - das sind Krebserkrankungen des lymphatischen Systems.
Mit einer Häufigkeit von jährlich drei bis vier Neuerkrankungen pro 100.000 Menschen ist die CLL die häufigste Leukämieform in den westlichen Industrienationen. Sie tritt meist im höheren Lebensalter auf, im Mittel mit 65 bis 70 Jahren. Vor dem 50. Lebensjahr ist eine chronische lymphatische Leukämie extrem selten. Eine CML kann grundsätzlich in jedem Alter vorkommen. Besonders häufig wird sie aber im sechsten Lebensjahrzehnt festgestellt.
Welche Ursachen haben chronische Leukämien?
Wie andere Krebsformen auch entstehen Leukämien als Folge von bestimmten genetischen Veränderungen. Im Fall der CML konnte sogar eine entsprechende Veränderung (Mutation) im Erbgut identifiziert werden. Wie genau und warum es zu solchen Genmutationen kommt, ist aber nach wie vor nicht restlos geklärt. Das heisst, gesicherte Ursachen für chronische Leukämien sind trotz aller Forschungsbemühungen bis heute nicht bekannt.
Allerdings konnte eine Reihe von Faktoren identifiziert werden, die das Risiko, an dieser Krebsart zu erkranken, erhöhen: Dazu gehören ionisierende Strahlen, also etwa radioaktive Strahlung, sowie bestimmte Umweltgifte und chemische Substanzen. Auch ein Zusammenhang mit Viren wird diskutiert. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickeln sich chronische Leukämien multifaktoriell: Damit es zur Erkrankung kommt, müssen verschiedene Faktoren zusammenwirken.
Wie äussert sich eine chronische Leukämie?
Chronische Leukämien sind oft ein Zufallsbefund. Das heisst, dass eine Erkrankung bei einer Routineuntersuchung entdeckt wird - meist durch eine erhöhte Anzahl von weissen Blutkörperchen, die sich in einem Blutbild zeigt. Dies liegt daran, dass die Erkrankung in der Regel sehr langsam verläuft und viele Patienten in den ersten Jahren somit beschwerdefrei sind.
Mit zunehmender Vermehrung der Leukämiezellen kann es dann zu verschiedensten Symptomen kommen. Diese Krankheitsanzeichen sind grösstenteils darauf zurückzuführen, dass die normale Blutbildung im Knochenmark beeinträchtigt bzw. unterbunden wird.
Werden nicht mehr genügend rote Blutkörperchen gebildet - entwickelt sich also eine Anämie -, kann sich dies in Form von Blässe, Abgeschlagenheit und verminderter Leistungsfähigkeit bemerkbar machen.
Durch den Mangel an funktionstüchtigen weissen Blutkörperchen können Krankheitserreger nicht mehr so effektiv bekämpft werden wie bei gesunden Menschen. Infolgedessen sind Patienten mit chronischer Leukämie anfälliger für Infektionen.
Eine verminderte Zahl an Blutplättchen erhöht die Blutungsneigung. Anzeichen dafür können häufiges Zahnfleischbluten, kleine, punktförmige Hautblutungen und eine Neigung zu Blutergüssen sein. Bei der CLL kommt es fast immer zum Anschwellen der Lymphknoten, bei der CML ist oftmals die Milz vergrössert.
Weitere mögliche Symptome sind Appetit- und Gewichtsverlust, allgemeines Unwohlsein sowie Fieber und Nachtschweiss. Alle genannten Beschwerden können indes auch bei anderen Krankheiten vorkommen; Symptome, die für eine chronische Leukämie spezifisch sind, gibt es nicht. Dieser Umstand macht es selbst in weiter fortgeschrittenen Stadien nicht immer einfach, die Erkrankung zu erkennen.
Wie wird die Krankheit diagnostiziert?
Krankheitsgeschichte und Beschwerdebild geben Arzt oder Ärztin erste Hinweise auf die Erkrankung. Daran schliesst sich zunächst eine ausführliche körperliche Untersuchung an. Bei Verdacht auf Vorliegen einer chronischen Leukämie wird eine Blutprobe genommen und im Labor untersucht. Im Regelfall zeigt sich die Zahl der Leukozyten im Blutbild deutlich erhöht.
Sicherste Methode zum Nachweis einer chronisch lymphatischen Leukämie ist eine sogenannte Immunphänotypisierung: Dabei wird untersucht, ob die Lymphozyten bestimmte Oberflächeneinweisse tragen, die sie von gesunden Lymphozyten unterscheiden.
Bei Verdacht auf eine chronische myeloische Leukämie ist zur Sicherung der Diagnose die Laboranalyse einer Knochenmarkprobe notwendig. Diese Probe wird üblicherweise mit einer dünnen Hohlnadel aus dem Beckenkamm entnommen (Beckenkammbiopsie).
Steht die Diagnose fest, schliesst sich unter Umständen noch eine Reihe weiterer Untersuchungen an. Sie dienen in erster Linie dazu, festzustellen, ob neben dem Knochenmark noch weitere Organe von den Leukämiezellen befallen sind.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Eine chronische Leukämie sollte zumindest anfangs immer in einer spezialisierten Klinik behandelt werden. Dort stehen sowohl entsprechend qualifiziertes Fachpersonal als auch die modernsten Therapieverfahren zur Verfügung. In weiterer Folge kann die Behandlung unter Umständen auch ambulant bzw. bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten erfolgen. Grundsätzlich hängen Art und Durchführung der Therapie stets davon ab, an welcher Leukämieform der Patient leidet und wie weit die Erkrankung bereits fortgeschritten ist.
Im Fall der CML kann eine dauerhafte Heilung nur durch eine Knochenmark- oder Stammzelltransplantation mit Gewissheit erreicht werden. Hierbei wird das gesamte blutbildende System - und damit im Idealfall auch alle Leukämiezellen - durch eine Hochdosis-Chemotherapie und gegebenenfalls Strahlentherapie vollständig zerstört. Im Anschluss erhält der Patient blutbildende Stammzellen von einem passenden Spender. Diese Stammzellen siedeln sich im Knochenmark an und führen nach einem gewissen Zeitraum wieder zu einer normalen Blutbildung. Allerdings kommt diese Therapie nicht für jeden Patienten und jede Patientin in Frage - etwa weil der Zustand der erkrankten Person die Durchführung dieser riskanten und belastenden Methode nicht zulässt.
Ob sich auch die CLL durch eine Stammzelltransplantation dauerhaft heilen lässt, müssen entsprechende Studien noch zeigen. Wegen des sehr langsamen Verlaufs wird diese Leukämieform meist erst behandelt, wenn krankheitsbedingte Beschwerden auftreten. Standard ist dann eine Chemotherapie. Klassische Chemotherapeutika sind Substanzen, die als Zellgifte wirken. Diese auch Zytostatika genannten Mittel vernichten Krebszellen bzw. hemmen deren Teilung, greifen aber auch gesunde Körperzellen an und können somit - teils gravierende - Nebenwirkungen hervorrufen. Die häufigsten unerwünschten Nebenwirkungen einer zytostatischen Chemotherapie sind Ãœbelkeit und Erbrechen, Schleimhautentzündungen, Haarausfall und Veränderungen des Blutbilds.
Zur Behandlung der CML gibt es seit einigen Jahren einen neuen Wirkstoff, der inzwischen therapeutischer Standard ist: Im Gegensatz zu anderen Zytostatika wirkt Imatinib spezifisch auf Leukämiezellen und hemmt deren Vermehrung. Gesunde Körperzellen werden nicht geschädigt. Deshalb verursacht der zu den Tyrosinkinase-Hemmern gehörende Wirkstoff verhältnismässig wenig Nebenwirkungen. Ob Imatinib die CML vollständig heilen kann, ist derzeit noch offen. Fest steht aber, dass sich das Fortschreiten der Erkrankung durch die tägliche Einnahme des Medikaments bei vielen Patienten lange Jahre aufhalten lässt. Mittlerweile sind in Österreich auch Tyrosinkinase-Inhibitoren der zweiten Generation (Dasatinib, Nilotinib) erhältlich. Derzeit sind diese Präparate bei Patientinnen und Patienten mit einer Imatinib-Resistenz oder -unverträglichkeit zugelassen.
Zunehmenden Stellenwert in der Behandlung chronischer Leukämien besitzen auch die sogenannten therapeutischen Antikörper. Anders als die klassischen Chemotherapeutika wirken sie gezielt auf den entarteten Zelltyp und bewirken dessen Zerstörung. Das zu dieser neuen Generation von Medikamenten, die auch als Immuntherapeutika bezeichnet werden, zählende Präparat Rituximab hat bereits einen festen Platz in der Behandlung der chronischen lymphatischen Leukämie.
Die Zerstörung von Krebszellen im Rahmen einer Strahlentherapie ist bei chronischen Leukämien nur von untergeordneter Bedeutung. Von Sonderfällen abgesehen wird sie eigentlich nur im Zusammenhang mit einer Stammzelltransplantation eingesetzt. Nebenwirkungen der Strahlentherapie sind Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Ãœbelkeit und Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen sowie Reizungen von Haut und Schleimhäuten.
Welche Prognose haben chronische Leukämien?
Die einzige Möglichkeit, eine chronische myeloische Leukämie mit Gewissheit zu heilen, ist die Stammzelltransplantation. Dieses Verfahren ist aber riskant und kommt nicht für jeden Patienten infrage, zumal es nicht leicht ist, einen passenden Spender zu finden. Durch die Einführung und Weiterentwicklung von Tyrosinkinase-Hemmern steht heute aber eine sehr wirksame alternative Therapiemethode zur Verfügung, die es vielen Betroffenen ermöglicht, mit ihrer Krankheit viele Jahre weitgehend beschwerdefrei zu leben.
Gleiches gilt bei optimaler Behandlung auch für die chronische lymphatische Leukämie. Eine vollständige Remission, also ein Zurückdrängen der Erkrankung, sodass diese mit konventionellen Methoden nicht mehr nachgewiesen werden kann, lässt sich durch die Immun-Chemotherapie heute bei vielen Betroffenen erreichen - und oft über einen Zeitraum von vielen Jahren aufrechterhalten. Eine ursächliche Heilung ist mit den bislang verfügbaren Medikamenten aber nicht möglich. Das bedeutet, dass es im Laufe der Zeit zu einem erneuten Auftreten der Erkrankung (Rezidiv) kommen kann. Aus diesem Grund spielt die Nachsorge eine besonders wichtige Rolle.